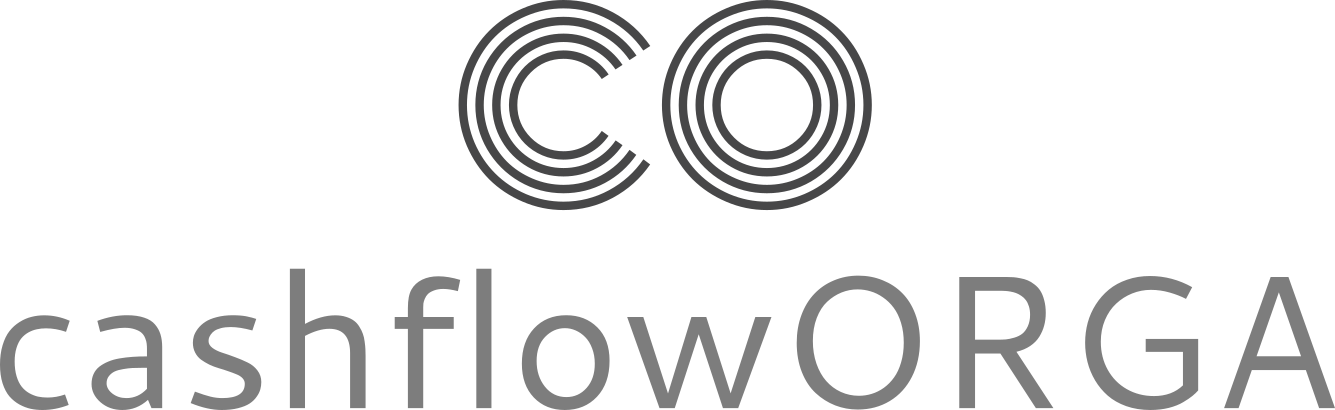Unternehmen in der Krise
Es wird für einen Unternehmer keineswegs leichter, Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Unternehmen schon mitten in der Krise steckt. Zwar ist sie dabei offensichtlich und man wird kaum noch der Versuchung unterliegen, weiterhin die Krise zu leugnen - weil der größte Teil der Belegschaft durchaus verstanden hat, dass die Firma in Schieflage geraten ist.
Der Geschäftsführer oder Vorstand müssen sich in dieser Situation allerdings bewusstwerden, dass es Fehler aus der Vergangenheit waren, die von der Chefetage zu verantworten sind. Dies ist mit großem Abstand die größte Hürde bei der Bewältigung der Krise. Dieser Moment birgt nicht weniger in sich, als die Erkenntnis, als Geschäftsleiter versagt zu haben, und jetzt dazu stehen zu müssen, bevor es zu spät ist.
Weltweit tendieren Unternehmensbosse dazu, weiteres Geld in einen verlustbehafteten Bereich zu versenken, um die Auswirkungen der Krise unsichtbar zu machen, was die tatsächliche Krise noch verschärft. Dies geschieht in aller Regel, damit der Geschäftsleiter vor sich und der Belegschaft noch eine Weile das Bild des Lenkers abgeben kann, der alles im Griff hat. Es bedarf keiner Phantasie, um sich auszumalen, wo dies hinführt.
Die Definition einer Krise
Ganz allgemein gilt ein Unternehmen als ‚in der Krise steckend‘, wenn nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden kann, dass das Unternehmen fortzubestehen in der Lage ist. In der betriebswirtschaftlichen Definition wird meist beigefügt, dass diese Situation weder geplant noch gewollt ist, obwohl schon dieser Aspekt durch so manche inszenierte Firmenpleite widerlegt wurde.
Zudem ist die Krise kein Dauerzustand, sondern wird – zumindest in der Definition – als zeitlich begrenzt beschrieben.
Woher kommen Krisen
Es ist unbenommen, dass Krisen von außerhalb über die Firma hereinbrechen können. Diese sogenannten exogenen Schocks kündigen sich nicht an, und es existieren daher auch nur wenige Mittel, sich vor einer solchen Krise zu schützen.
Das prominenteste Beispiel für eine exogene Krise ist die auf das ganze Land, den Kontinent oder die Welt bezogene gesamtwirtschaftliche Rezession, die oft selbst die Bezeichnung Krise trägt: Ölkrise, Dotcom-Krise oder Immobilienkrise sind die bekanntesten Rezessionen der Moderne. Auch Gesetzesänderungen können ein Unternehmen aus der Bahn werfen, wenn beispielsweise eine neue Verordnung ein Herstellungsverfahren erzwingt, das nicht durch Produktverkäufe refinanziert werden kann. Oder – was noch häufiger ist – wenn der Gesetzgeber ein Verfahren verbietet, das jahrzehntelang profitabel eingesetzt wurde.
Häufiger als die äußeren, sind allerdings die endogenen Ursachen. In diesen Fällen sind die Probleme hausgemacht. Endogene Krisen kündigen sich üblicherweise lange vorher an. Sie sind jedoch im Normalfall an die Entscheidung einzelner Personen oder kleiner Gremien geknüpft – und damit beginnt das Problem.
Wenn es nach den Führungsetagen in deutschen Unternehmen geht, dann ist jede Krise unvermeidbar, kommt von außen, war nicht zu verhindern und auch nicht vorauszusehen – eine typische endogene Schockwirkung. Ob es auf die schlechte Konjunktur geschoben wird, oder auf sich ändernde Rahmenbedingungen, die von der Politik initiiert wurden – der Unternehmer geriert sich dann gerne als Opfer politischer Ränke, die – frisch geschmiedet – seiner Firma den Garaus gemacht haben.
Der deutschen Manager liebste Krise ist diejenige, die keinen Verantwortlichen hat
In den meisten Fällen verhält es sich jedoch mitnichten so. Fast jede Krise lässt sich auf Versäumnisse in der Geschäftsleitung zurückführen. Dafür gibt es Verantwortlichkeiten. Doch ein in letzter Zeit eher zunehmender als abnehmender Trend ist die Installation von Managern, die keine Verantwortung übernehmen. Das ehrbare (und nicht der Wahrheit entsprechende) Bild vom Kapitän, der mit seinem Schiff untergeht, während alle anderen Crewmitglieder und die Passagiere sich retten können, findet man in heutigen Unternehmen nur noch höchst selten.
Falsche Entscheidungen bei der Besetzung von Führungspositionen
Es sind immer die Führungskräfte, die in einem Unternehmen über Wohl und Wehe entscheiden. Entsprechend penibel wird eine Neubesetzung in der Führungsetage überdacht und geprüft – sollte man meinen. Dabei fallen immer wieder drei Kardinalfehler besonders auf:
Verlassen auf Papier und Versprechungen
Jeder Bewerber, der sich für die höheren Weihen innerhalb der Firmenhierarchie seines neuen Wunsch-Arbeitgebers empfehlen möchte, untermauert dies mittels eines Stapels an Empfehlungen und Zeugnissen. Die Offenheit, mit der im Internet auch intime Informationen über einen Kandidaten recherchiert werden kann, täuscht darüber hinweg, dass die Qualität einer Führungsperson schwer in Worten oder gar Zahlen zu beschreiben ist.
So ist es für keinen Kandidaten in der Auswahlliste für eine neu zu besetzende Position im Management ein größeres Problem, ein breit gefächertes Bouquet an Informationen zu beschaffen, die darauf hinweisen, wie brillant dessen Arbeit in der vorangegangenen Position gewesen ist. Wer dies nicht zu bringen im Stande ist, kommt gar nicht in die enge Auswahl.
Dieses Verfahren ist voll und ganz passend bei einfachen Positionen bis hin zur Team- bzw. Gruppenleitung. Für erfolgreiche Manager muss es aber möglich sein, ganz andere Fragen zu beantworten.
· Kann er bei seinen Erfolgen der Vergangenheit plausibel belegen, warum andere Kandidaten in der gleichen Situation gescheitert wären, und nur er erfolgreich war?
· In welcher Situation haben seine Entscheidungsfähigkeit und seine Initiative in Zeiten schweren Seegangs ein Projekt vor dem Untergang gerettet – und wie?
· Welche Beispiele kann er oder sie nennen, in denen kreative, unkonventionelle oder sogar unorthodoxe Wege einen Erfolg gebracht haben, der sonst nicht eingetreten wäre?
Verschiedene Untersuchungen legen nahe, dass auch für Führungspositionen eine Matrixentscheidung die besten Ergebnisse liefert – zumindest der Statistik nach. Personalentscheidungen, die nach ‚weichen‘ Gesichtspunkten, oder nach dem oft genannten ‚Bauchgefühl‘ getroffen wurden, ziehen demnach eine kürzere durchschnittliche Verweilzeit nach sich, als solche, die auf starren Vorgaben getroffen wurden.
Dies zeigt nicht zwangsläufig, dass Kreuzchen in einer Tabelle der beste Weg sind, eine Führungsposition zu besetzen – eher ist es ein Zeichen dafür, dass ganz allgemein bei der Einstellung von Führungspersonal zu wenig Sorgfalt walten gelassen wird.
Beides ist also falsch: sowohl, sich vom Bauchgefühl leiten zu lassen, als auch, sich blind auf Papier und Zahlen zu verlassen. Ein neues Mitglied im Top-Management muss auf alle möglichen Weisen x-fach geprüft werden – und wenn es fünf bis zehn Gesprächstermine kostet.
Überbewertung des Fachgebiets
Jede Führungsperson muss an einer Stelle seiner Karriere den Schritt vom Arbeiter zum Leiter machen – ob dies nun auf Teamebene oder gleich für eine ganze Abteilung geschieht. Ob der Aufstieg intern erfolgt, oder mit einem Wechsel des Unternehmens einhergeht – eine Überlegung bleibt stets die gleiche: Womit soll der zukünftige Manager gezeigt haben, dass er die Werkzeuge der Personalführung beherrscht?
Vor allem bei Wechseln innerhalb eines Unternehmens ist häufig das gleiche Bild zu sehen: Der fähigste Entwickler im Team, der erfolgreichste Verkäufer der Region oder die emsigste Schreibkraft der Büroetage werden in die Gruppenleitung berufen, wenn dort eine Position zu besetzen ist – doch damit sind sofort zwei Probleme geschaffen worden, die zuvor nicht existiert haben.
Erstens fehlt dem Team bei der operativen Arbeit der bisher produktivste Mitarbeiter, und zweitens muss der neue Leiter ohne Übergangszeit einen Wechsel in der Denkweise vollziehen, denn er oder sie darf nicht mehr in der Kategorie ‚Lösungen für Aufgaben‘ denken, sondern muss Ziele, Wege und Strategien für das Team erschaffen.
Es ist keine leichte Aufgabe, das beste Teammitglied zu übergehen, um einen vermeintlich besser für die Leitung geeigneten Kandidaten vorbeizuziehen, doch die beiden genannten Probleme werden immer im Spiel sein, wenn einfach ‚der Beste aus dem Team‘ befördert wird.
Scheu vor dem ‚zu guten‘ Kandidaten
Der Wunschkandidat für eine Führungsposition soll eine ganze Reihe an Talenten mitbringen. Neben der Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren, soll er ein gutes Vorbild sein. Seine Kreativität wird in schwierigen Geschäftsentscheidungen den richtigen Weg vorgeben. Fachlich ist er so versiert, dass er seinen Untergebenen stets auch in alltäglichen Situationen eine Hilfe ist – und ganz allgemein versteht er es, aus einer zusammengewürfelten Gruppe an Individuen ein Team zu formen, das im Kollektiv eine größere Leistung auf die Straße bringt, als es die Summe der Einzelnen wäre.
Nur allzu oft zeigt ein solcher Kandidat, wenn er dann gefunden wurde, dem Vorstand oder der Geschäftsleitung deren eigene Unzulänglichkeiten auf – auch ohne dies gezielt zu wollen. Schon im Rahmen der Bewerberselektion wird dies als unausgesprochene Bedrohung wahrgenommen. Der Kandidat scheitert, und dem Unternehmen entgeht ein Mitarbeiter, der ganze Bereiche weit nach vorne hätte bringen können.
Deshalb: keine Angst vor den Top-Kandidaten. Bewahren Sie sich als Führungskraft genügend Selbstbewusstsein, und fürchten Sie nicht, dass ein neuer Manager an Ihrem Stuhl sägen könnte.
Falsche Einschätzung der Marktentwicklung
Markteinschätzungen sind traditionell ein Bereich, der von viel Optimismus – bis hin zur Realitätsverweigerung – getragen ist. Liegt der Chefstratege allerdings zu weit daneben, sind die Kosten immens. Sowohl die Produktentwicklung, als auch Marketing- und Vertriebskampagnen benötigen Vorlauf – ganz zu schweigen von PR oder Veranstaltungen, die auf Aktionäre, Investoren und Analysten ausgerichtet sind. Gute Planung und Vorbereitung sind unabdingbar – und es ist fast immer eine Situation, in der es nur einen Versuch gibt, und der muss auf Anhieb sitzen.
Entscheidungen auf dieser Ebene tragen viele Folgen nach sich, und die Verantwortung für Änderungen bei der Strategie in Bezug auf die Marktbesetzung ist niemals gering. Dies bringt viele Unternehmer dazu, an den eingeschrittenen Wegen gar nichts zu ändern, und darauf zu vertrauen, dass die Dinge, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, auch in Zukunft einschlagen werden.
In diesem Szenario ändern sich die Märkte über kurz oder lang vom vorhandenen Produkt oder der vorhandenen Strategie weg. Wenn dies erst dann bemerkt wird, wenn Umsätze eingebrochen sind, dann ist es meist zu spät.
Ein wesentlicher Aspekt der Veränderungen am Markt sind neue Konkurrenten und neue Technologien. Trends und Moden gibt es in allen Branchen. Da der Markt ein großes, lebendiges und vielfältiges Etwas ist, folgen nicht alle Trends nur pragmatischen Gesichtspunkten. Solche Entwicklungen vorherzusehen, ist oft ein Glücksspiel. Darauf zu warten, bis ein Trend offensichtlich wird – und dann erst zu reagieren – führt immer ins Nachsehen.
Große Konkurrenten und neue Technologien kündigen sich im Vergleich dazu meist lautstark, aber immer lange vorher an. Ein Unternehmen, das hierauf nicht in der Lage ist, zu reagieren, bzw. sich vorab darauf einzurichten, hat den Untergang selber beschlossen.
Die Tragweite der Versäumnisse kann in eine Reihenfolge gebracht werden:
1. Nicht-Erkennen oder spätes Erkennen eines Trends, der nicht absehbar war: tendenziell geringerer Schaden
2. Unvorbereitet auf einen sichtbaren Trend sein: deutlich größerer Schaden
3. Nicht-Reagieren auf einen offensichtlichen Trend wie neue Technologien oder Konkurrenten: großer Schaden
Der größte Schaden entsteht, wenn das Bewusstsein, sich auf zukünftige Märkte auszurichten, vorhanden ist, aber nachlässig umgesetzt wird.
„Die meisten Spieler sind ziemlich gut, aber sie laufen dahin, wo der Puck ist. Ich gehe dahin, wo der Puck sein wird!“ - Wayne Gretzky
Dieses Zitat wird dem bekannten Kanadischen Eishockey-Spieler Wayne Gretzky zugeschrieben. Die Weisheit, die darin enthalten ist, gilt im übertragenen Sinne auch für Markteinschätzungen. Die ganze Strategie eines Unternehmens inklusive PR, Marketing, Produktentwicklung, muss im Idealfall darauf ausgerichtet sein, wo der Markt als nächstes sein wird, und nicht, wo er gerade ist. Gelingt dieses Kunststück, sind die Gewinne astronomisch. Geht die Strategie allerdings am Markt vorbei, drohen immense Verluste.
Umso unverzeihlicher ist es, wenn sich ein Unternehmen in eine Richtung orientiert, in der die Verantwortlichen nur hoffen, dass der Markt sich entwickeln wird. Daher ist die vierte Position:
4. Leichtsinniges Hoffen auf eine Marktentwicklung, die nicht eintritt: größtmöglicher Schaden
Wir können es gar nicht genug betonen: Auch die aufwändigste Analyse des Marktes, Abschätzung der Trends, Umgestaltung des Produktmanagements sind ihre Kosten wert, wenn auf der Gegenseite der Umstand steht, dass das Unternehmen am Markt vorbei produziert.
Übertriebene Ambitionen in Bezug auf Expansion des Unternehmens
Ein gewisser Hang zur Expansion wohnt den meisten Unternehmen inne. Darin liegt auch der Wunsch begründet, beim Verlust eines Teilbereiches aus anderen Unternehmensteilen Gewinne zu ziehen. Diese Art zu expandieren ist im Sinne des Unternehmens, und daher zu befürworten.
Häufig lässt sich aber auch ein Wunsch zur Expansion ‚auf Biegen und Brechen‘ beobachten. Dahinter steckt dann keine kluge Strategie, sondern das Streben nach Marktmacht und Aufmerksamkeit. Um dieses Wachstum zu beschleunigen, werden andere Unternehmen, Produkte, Patente oder Marken gekauft. Solches Wachstum ist nicht grundsätzlich schlecht, jedoch führen eine zu große Geschwindigkeit und ein ungünstiges Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdmitteln regelmäßig zu großen Krisen. Noch nachhaltig negativer wirkt sich das Firmenwachstum aus, wenn in eine strategisch falsche Richtung expandiert wird.
In Unternehmerkreisen kursiert der Begriff des ‚biologischen Wachstums‘. Damit geht ein Ausbau des Marktanteils, aber auch die Erschließung neuer Märkte mit eigenen Entwicklungen einher. Biologisches Wachstum geht in der Regel langsamer vonstatten und wird gemeinhin als gesünderes Wachstum gewertet. Fehlentwicklungen können zum Beispiel mit deutlich weniger Verlust gestoppt oder ersetzt werden.
Das ungesunde Wachstum durch mehr oder weniger passende, oft nur ungenügend überlegt, und oft mit geliehenem Geld – diese Strategie der übertriebenen Ambition führt regelmäßig in die Krise.
Weitere Ursprünge von Krisen
Krisen können vielfältige Gründe haben. Manche gehen auf kapitale Fehlentscheidungen zurück und haben entsprechend weitreichende Konsequenzen. Auf anderen Gebieten können sich Fehlentwicklungen unbemerkt einschleichen, und ebenfalls zur Krise führen.
Verlust der Kundenorientierung
Diese Überschrift könnte manchen Leser oder manche Leserin in die Irre führen. Kundenorientierung bedeutet – gemäß der uralten Vorgabe, dass der Kunde König sein solle – eine Ausrichtung auf Information als Bringschuld, Service als Selbstverständlichkeit sowie problemlose Erreichbarkeit, genauso wie Transparenz und Menschlichkeit.
Dabei wird gerne vergessen, dass die Kundenorientierung auch in die andere Richtung verloren gehen kann. Jeder Anbieter befindet sich zwar in einer Konkurrenzsituation zu anderen Herstellern vergleichbarer Güter, und geschickte Kunden nutzen diese Situation als Hebel für eine bessere Verhandlungsposition. Hierbei gibt es häufig Kandidaten, die es übertreiben.
Vorausschauende Akteure finden jedoch Mittel und Wege, diesem Missbrauch zu entgehen. Wie stand schon in den Sprüchen Salomos (30, V. 33):
…wer die Nase hart schneuzt, zwingt Blut heraus – Luther 1914
Den Kunden dazu zu ermuntern, seine Käuferposition zu überspannen, führt zu unrentablen Geschäften. In Manchen Branchen, häufig zu finden im Dienstleistungssektor, haben Preiskämpfe zu einer Situation geführt, in der zwar alle Anbieter Aufträge haben, aber keiner wirklich davon leben kann.
Mit dem Verlust der Kundenorientierung ist hier also kein Fehler des Unternehmens gemeint, sondern ein unguter Trend. Diesem kann man entgegentreten, in dem die Werbe- bzw. Marketingausgaben erhöht, und auf diese Weise lukrativere Geschäfte an Land gezogen werden.
Gestaltung des Produktprogramms
Die Produktgestaltung wird von der Nachfrage des Marktes und den Herstellungskosten diktiert – sollte man meinen. Ganz so einfach ist es nicht. Je nach Renommée des Herstellers spielen gewisse Ansprüche an Qualität oder Design eine solch große Rolle, dass darüber durchaus die rein Wirtschaftlichen Gesichtspunkte in den Hintergrund treten.
Obwohl es günstigere und gleichwertige Verfahren gibt, lässt die Firma Apple den Corpus der High-End-Laptops aus dem Vollen fräsen. Dies ist der Anspruch, den die Kunden haben, wenn sie ein MacBook kaufen. Auch andere Hersteller wie Bang & Olufsen im HiFi-Bereich, Miele bei Haushaltsgeräten oder nicht zu vergessen die Premium-PKW-Hersteller, haben Ansprüche an Design, Funktionalität, Qualität und Langlebigkeit, die als wichtiger angesehen werden im Vergleich zu der reinen Relation aus Stückkosten und Marktpreis.
In dieser komplexen Gemengelage ist genug Platz für Fehleinschätzungen und falsche Ausrichtungen, um – wenn die Schäden sich unbemerkt einschleichen können – ganze Unternehmen an den Rand des Ruins zu bringen. Der Billig-Sektor ist überschwemmt mit Konkurrenz, der Premium-Sektor muss langsam erobert werden, und erfordert ein geduldiges Portemonnaie für die Werbekampagne. Die Nische, die für Ihr Unternehmen auf ganz natürliche Weise funktioniert, sollten Sie sorgsam aussuchen.
Falsche Entscheidungen bei technologischer Ausstattung, Rohstoffsicherung oder Standortwahl
Hier fassen wir verschiedene Bereiche zusammen, bei denen es kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ gibt, sondern die nach individuellen Gesichtspunkten für jedes Unternehmen anders entschieden werden und entschieden werden müssen.
Es sind dies jedoch Beispiele für wesentliche Themen, die große Auswirkungen haben. Gleichwohl lässt sich immer wieder beobachten, dass gerade bei solchen Themen die nötigen Entscheidungen lapidar getroffen werden, bar ihrer Wichtigkeit.
· Die technologische Ausstattung muss immer wieder erneuert werden, um nicht ins Hintertreffen zu geraten
· Die Rohstoffsicherung ist zum einen überlebenswichtig, zum anderen ein ständiger Posten, der sich – einmal gewählt – über Jahre zum Fluch oder Segen entwickelt
· Die Standortwahl ist insofern gut zu überlegen, als sie sich nur mit großem Aufwand ändern lässt
Viele Unternehmen kommen immer wieder ins Gerede, weil die Arbeitsplätze mit Computern ausgestattet sind, die schon zu viele Jahre auf dem Rücken haben. Als der Hersteller Microsoft im Jahre 2014 sein Betriebssystem „Windows XP“ endgültig zu begraben plante, weil die Nachfolgeversion Windows 7 und die Nach-Nachfolgeversion Windows 8.1 auch schon in die Jahre gekommen war, und Windows 10 vor der Tür stand, mussten Sie an viele hunderttausend Lizenznehmer Nachrichten versenden, dass Windows XP fortan ein Sicherheitsrisiko sei. Dies waren alles Lizenzen, die noch in Unternehmen an den Arbeitsplätzen installiert waren. Privatleute hatten längst ihre PCs und Laptops auf den Stand von Version 7 oder 8 gebracht.
Unvergessen zum Thema Standortwahl ist eine Anekdote, die wohl kolportiert, jedoch nie offiziell bestätigt wurde. Unter Porsche-Chef Wendelin Wiedeking verlegte das Unternehmen die Bereiche Design, Vertrieb, Lizenzgeschäft, Beratung und Finanzierung aus der Zentrale in Stuttgart-Zuffenhausen ins 20 Kilometer entfernte Bietigheim-Bissingen. Mit dieser Entscheidung ging der Bau eines gläsernen Büroturms einher, der seitdem den Ortseingang Bietigheims aus der Richtung Ludwigsburg schmückt. Die Einwohner des schwäbischen Musterstädtchens erzählten sich die Geschichte, dass Wiedeking – der ebenfalls in Bietigheim sein Haus hatte – diese Entscheidung fällte, damit er nicht mehr so weit zur Arbeit fahren musste.
Woran wird eine Krise erkannt
Krisen haben viele Gesichter. Sie können sich unbemerkt einschleichen, Sie können sich auch offensichtlich einschleichen, aber nur durch Ignoranz unbemerkt bleiben. Manche Krisen werden – wie die vielfältigen Schäden durch die Lockdowns 2020/2021 – den Unternehmen übergestülpt, und manche Krisen kommen von außerhalb unaufhaltsam näher, auch wenn man sie schon von weitem sehen kann.
Die unfreiwillig von außen über die Unternehmen gegossenen Krisen, zu denen auch globale Wirtschaftskrisen, Unruhen oder Rohstoffknappheiten gehören, sind kaum zu vermeiden. Die Qualität des Managements zeigt sich in der Flexibilität, mit der auf die geänderten Situationen reagiert, und die zunächst katastrophal anmutenden Rahmenbedingungen in den Nährboden für eine Aufstiegsbewegung verwandelt wird. Darauf werden wir in einem gesonderten Kapitel detailliert eingehen.
Die übrigen der üblichen Krisen kündigen sich durch Signale an, die mal laut und mal leise sind. Weil diese Signale sich immer wiederholen, bestehen gute Möglichkeiten, sich für das eigene Unternehmen ‚Frühwarnsysteme‘ aufzubauen, die es zumindest zeitlich ermöglichen, die Krise zu verhindern oder zu umschiffen.
Für die jetzt genannten Signale gilt allerdings: Wenn Sie einen dieser Hinweise erkennen, dann hat sich die Krise schon am Frühwarnsystem vorbeigeschlichen – oder aber Ihr Unternehmen besitzt gar kein solches System.
Sinkende Umsätze
Umsätze bzw. deren Fehlen sind das deutlichste und unmissverständlichste Signal dafür, dass sich eine Krise ankündigt. Dabei wird von der Führungsriege Fingerspitzengefühl verlangt. Zum einen müssen auch kleinste Unregelmäßigkeiten bemerkt und bewertet werden, zum anderen dürfen auf keinen Fall die erwartbaren Schwankungen zu Überreaktionen führen.
Die Bewertung des Umsatzes muss saisonbereinigt erfolgen, um für die Krisenfrühwarnung von Belang zu sein. Zudem ist die Situation auf Einzelbegebenheiten abzuklopfen, die eine nur scheinbar unübliche Schwankung erklären würden. So kann zum Beispiel der Abgang eines überaus fähigen Mitarbeiters aus dem Vertrieb oder der Entwicklung – oder der Verlust eines Consultants – eine spürbare Produktivitätslücke hinterlassen, die in der besonderen Situation allerdings voll zu erwarten war.
Forderungsausfälle
Eine uneinbringliche Forderung bedeutet, pragmatisch beurteilt, nichts anderes, als dass das bezogene Unternehmen, der Debitor, bereits weiter ist auf dem Weg in die Krise, als die eigene Firma.
Fehlende Liquidität führt immer dazu, dass Verbindlichkeiten möglichst lange hinausgeschoben werden. Genauso wird aber auch die Krise dadurch nur in die Zukunft verschoben, jedoch nicht verhindert.
Vermehrte Kundenbeschwerden
Kunden sind, vor allem wenn Sie zu ehrlicher Kritik in der Lage sind, ein ausgezeichneter Gradmesser. Schwankungen in der Qualität oder bei der Pünktlichkeit nehmen Sie sensibler wahr, als das Ihr eigenes Unternehmen vermag – und sie können akkurat beurteilen, ob diese Schwankungen erwartbar sind, oder aus dem Rahmen fallen.
Über Kundenbeschwerden sollte schon in guten Zeiten eine auswertbare Datenbank existieren, und es versteht sich von selbst, dass eine Beschwerde auch inhaltlich höchste Beachtung finden muss.
Schrumpfende Liquiditätsreserven
Sinkende Umsätze, auf die nicht rasch mit flexiblen Maßnahmen zur Kostensenkung reagiert werden, führen unweigerlich zum Aufzehren der Reserven. Die aufmerksame Geschäftsleitung wird also nicht eines Tages plötzlich feststellen, dass die Liquiditätsreserven aufgebraucht sind, und davon überrascht sein. Wir werden später noch der Liquidität einige Aufmerksamkeit in diesem Buch widmen.
Unpünktliche Rechnungsbegleichungen
Die unweigerliche Folge fehlender Liquidität ist die Verschlechterung der Zahlungsmoral. Wird in der Buchführung noch als normal gelehrt, jedes Zahlungsziel erst am letzten Tag zu bedienen, wird diese Regel dann gestreckt auf den letzten Tag, an dem noch eine Zahlung ohne Verzugszinsen oder Säumniszuschlag geleistet werden kann, auch wenn das Zahlungsziel bereits überschritten wurde. In Extremfällen wird sogar der Verzug in Kauf genommen, und erst vor der letzten Frist bezahlt, die auf dem Vollstreckungsbescheid angegeben ist.
Verlust von Stammkunden
Stammkunden, die plötzlich auf einen anderen Lieferanten oder Dienstleister ausweichen, sind ein lautstarkes Alarmsignal. Je länger der Kunde eigentlich treuer Wiederbesteller war, desto schwerer wiegt sein plötzliches Abwandern. Dies gilt insbesondere, wenn es keinen Vorfall gab, der als Erklärung taugen würde – also zum Beispiel eine Beschwerde über unpünktliche Lieferung, schlechter Service, oder mehrfaches Rügen eines Mangels.
Achten Sie auf das Merkmal, wenn der Kunde einfach nicht mehr bestellt – im Gegensatz zu einem öffentlichen Schreiben, in dem der Kunde seine Entscheidung begründet, und sich für die gute Geschäftsbeziehung bedankt, die bisher gelebt war.
Langjährige Lieferanten, die auf Vorkasse bestehen
Ein Lieferant, der auf eine lange Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen zurückblicken kann – auch hier gilt: je länger und tiefer, desto schmerzlicher das Signal – und einst noch gewährte Zahlungskonditionen nicht mehr gewährt, ist das deutlichste Zeichen von völligem Vertrauensverlust.
Für Sie als Unternehmer muss offensichtlich sein, dass die Lieferanten den Zustand Ihres Unternehmens genauer und akkurater einschätzen, als das Ihre eigenen Spezialisten vermögen.
Zusammenfassung
Die Signale, die auf eine kommende Schieflage hinweisen, schließen sich gegenseitig nicht aus. In der Betrachtung einer typischen Unternehmenssituation im Rückspiegel wird regelmäßig deutlich, dass es gleich mehrere Anzeichen gab, die eine Warnung hätten sein müssen.
Auf dem Weg in die Krise überfährt ein Geschäftsleiter meist deutlich mehr als nur ein Stoppschild
Durch unsere Schilderungen sensibilisiert sollte sich jetzt allerdings schon früher eine Handlungsbereitschaft einstellen. So kann die Krise vielleicht noch vermieden werden.
Der Selbstcheck
Viele Dinge des geschäftlichen Alltags sind nicht ungewöhnlich und eigentlich auch nicht besorgniserregend – wenn sie ab und zu mal passieren. Achten Sie bei den folgenden Punkten darauf, ob sie in jedem oder fast allen Ihrer Projekte in der einen oder anderen Art auftauchen – denn dann ist dies der Zeitpunkt, Alarm zu schlagen.
Prüfen Sie: …ob Angebote und Kundenanforderungen sich entsprechen
…und ob die Kalkulation passt. In vielen Branchen werden Produkte umgesetzt, die einen Preis haben, und zu dem sie auch in den Verkauf kommen. Manchmal wird etwas hin und her verhandelt, aber der Preis ändert sich nicht sehr stark – und steht vor allem von Anfang an fest.
Bei großen Projekten mit Dienstleistungsanteil sieht es ganz anders aus. Hier kann kaum ein fester Preis genannt werden, der schon von Anbeginn bekannt ist. Dafür sind Projektanforderungen zu weich, und Unwägbarkeiten im Projektverlauf zu schwer einschätzbar.
Trotz all dieser Hindernisse müssen Geschäfte irgendwie zustande kommen. Aus diesem Grund werden im Regelfall nur Aufwandsabschätzungen abgegeben.
Es ist dabei ein ungeschriebenes Gesetz, dass der nach Projektabschluss fällige Betrag nicht zu weit vom Schätzbetrag abweicht.
Genau das geschieht allerdings immer wieder. Der Verhandlungsführer hat einen Schätzpreis genannt, und der Kunde hat zu diesen Konditionen eingeschlagen. Dem Projektleiter wird allzu schnell klar, dass mit diesem Budget das Projekt nicht zu stemmen ist.
Wenn dies in Ihrem Unternehmen regelmäßig geschieht, dürfen Sie sich schon einmal auf die Krise einstellen, denn Ihr Betrieb wird so kaum lukrativ arbeiten können. Ob der Verhandlungsführer Schwierigkeiten hat, die wahren Kosten für ein Projekt knallhart auf den Tisch zu legen, oder ob Ihre Projektleiter zu ungenau mit der Kostenschätzung sind – oder ob am Ende nur die Kommunikation zwischen diesen beiden Teams der Schwachpunkt ist – Sie werden sich in jedem Fall auf die Fehlersuche begeben müssen.
Prüfen Sie: …ob die Kosten im geplanten Rahmen liegen
Bei Kosten, die nicht als Teil von Projekten entstehen, gibt es ebenfalls oft Lecks und Löcher. Die Prüfung, ob Kosten im Rahmen liegen, geschieht anhand der Kostenart im Vergleich zum Jahresumsatz. Es gibt vielfältige Listen von Richtwerten, in denen die Kostenart genannt wird, zusammen mit einem Prozentwert des Umsatzes, der für diese Kostenart üblich ist – und das Ganze noch sortiert nach Branchen. Häufig sind diese Materialien in englischer Sprache verfasst. Suchen Sie also, um zum Beispiel den Wert für Ihre IT-Abteilung herauszufinden, nach „IT Spending as a Percentage of Revenue“ im Internet. Meist erhalten Sie dann noch eine Branchenunterscheidung, „Industry“ genannt, aus der Sie Ihren Geschäftszweig auswählen.
Anhand der Größenordnungen, die Sie in diesen Listen finden, können Sie abschätzen, ob Ihre eigenen Kosten aus dem Rahmen fallen – und entsprechende Maßnahmen durchführen.
Prüfen Sie: …ob Projekte oder Baustellen im Zeitplan sind
Egal, was Sie vorhaben, ob ein internes Projekt oder ein vom Kunden stammender Auftrag: Sie haben dafür eine bestimmte an Menge Zeit eingeplant. Bei guter Planung liegen Sie manchmal darüber, manchmal darunter. Liegen Ihre Projekte zeitmäßig immer über dem Budget, müssen Sie sich ebenfalls auf Fehlersuche begeben.
Wenn Ihre Zeitplanung an einer Stelle häufig aus dem Ruder läuft, kann es durchaus sein, dass sich durch Ihr ganzes Unternehmen ein roter Faden aus schlechter Planung und uneffektiver Leistungserbringung zieht. Ihre Firma wird sich schon bald in einer Krise befinden, wenn Sie nicht umgehend handeln. Auf der anderen Seite steht die Chance, einen Bereich nach dem anderen auf Schlankheit der Prozesse abzuklopfen, und Ihr Unternehmen auf diese Weise zu verjüngen und wirklich fit zu machen. Um hier strukturiert und lückenlos zu agieren, kann Ihnen ein Unternehmensberater den Weg zeigen.
Prüfen Sie: …ob bei den Kontobüchern alles korrekt ist
Eine faszinierende Eigenschaft in der Buchführung ist die, dass man gar nicht alles wissen muss, um alles zu wissen. Im Rahmen einer funktionierenden Buchführung ist es niemals notwendig, auf das Bankkonto zu schauen, um den Kontostand zu erfragen, denn der ergibt sich aus der Kombination aller anderen Buchungen.
Umso sinnvoller ist es, genau aus diesem Grund doch ab und zu einmal einen Blick auf den Kontostand zu werfen. Eine Diskrepanz bedeutet ohne weitere Umwege, dass etwas nicht stimmt. Buchhalterisch gesehen ist das nicht tragisch. Wenn die Firma Betriebsmittel einkauft und per Bankeinzug bezahlt, wird sie erst einmal nicht ärmer. Aber der Stand auf dem Bankkonto ändert sich – und das hat fatale Folgen.
Liquidität verzehnfacht ihre Wichtigkeit, wenn sie gebraucht wird, aber nicht vorhanden ist
Neben dem Buchwert einer Firma gibt es eine Kenngröße, die gleichzusetzen ist, mit der Lebensader eines Organismus – und das ist die Liquidität. Deshalb sind die Kontostände ständig zu prüfen. Auch wenn eine Buchung – der Kauf eines Gegenstandes und die Bezahlung über das Bankkonto – nichts an der Bilanz ändert, und deshalb gegenstandslos sein könnte: In dem Augenblick, in dem flüssige Mittel gebraucht werden, müssen sie auch zur Stelle sein. Unterschätzen Sie niemals die Wichtigkeit von Liquidität!
Prüfen Sie: …ob die Finanzierung passt
Natürlich passt die Finanzierung – aber nur, wenn sie passt. Der Fall wiederholt sich häufig: um die Chancen auf eine Darlehensvergabe zu erhöhen, halten viele Verhandlungsführer es für eine gute Idee, die Kosten für die Investition möglichst nach unten zu rechnen. Dieses Vorgehen ist auf zweierlei Arten falsch.
Erstens werden die Kosten aus dem Ruder laufen, und Sie kommen schnell in die Situation, in der Sie Zusatzdarlehen benötigen. Das ist die Sorte Darlehen, bei der Sie sich Geld leihen, um ein anderes bereits laufendes Darlehen bedienen zu können. Es muss nicht weiter beschrieben werden, wie schnell Sie mit Ihrer Firma auf diese Weise in der schlimmsten aller Krisen landen – der Liquiditätskrise.
Wahrscheinlich kommt es allerdings gar nicht so weit. Die Sachbearbeiter auf der Bank prüfen die Anforderung sehr genau – und sie prüfen auch die jeweilige Person, die mit ihnen spricht. Wenn Sie Ihre Investition künstlich kleingerechnet haben, ist es sehr gut möglich, dass Ihr Berater das erkennt.
Zu Ihrer Überraschung erhalten Sie dann den abschlägigen Bescheid, mit der Begründung, dass die Bank nicht überzeugt ist, dass Ihre Investition von Erfolg gekrönt sein wird.
Besser ist es, die Kosten, die zu erwarten sind, gnadenlos auf den Tisch zu legen, und lieber noch einen Sicherheits-Spielraum nach oben zu lassen.
Bedenken Sie all dies, wenn Sie für eine größere Angelegenheit planen, Geld aufzunehmen.
Prüfen Sie: …welche Vertriebsmaßnahmen erfolgreich sind.
Vertrieb ist nicht gleich Vertrieb. An anderer Stelle in diesem Ratgeber ist zu lesen, in welcher Weise der Vertrieb im Wandel ist. Bedingt durch den Wandel der Märkte, der Methoden und der technologischen Möglichkeiten, ist der Vertrieb in der heutigen Zeit kaum noch zu vergleichen mit dem, wie der Vertreter vor 30 Jahren seine Runden gedreht hat, um seine Kunden zu sehen.
Den Vertrieb besser zu strukturieren, ist eine vergleichsweise einfache Aufgabe. Wenn etwas gut funktioniert, dann ist das Ergebnis sehr schnell zu sehen. Allerdings muss man dazu verstehen, was es im Detail ist, das nicht optimal läuft, und in der Lage sein, die Methode zu isolieren, die der Verbesserung bedarf. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen externen Berater zu engagieren, der auf die Optimierung von Vertriebsmaßnahmen spezialisiert ist?
Eine Steigerung der Effektivität wirkt sich linear auch auf den Umsatz aus – und Maßnahmen, die erfolgreich umgesetzt wurden, bleiben auch eine Weile lang erfolgreich.
Formen der Krise
Strategische Krisen
Eine strategische Krise ist die nachhaltigste und schädlichste Krise, die einem Unternehmen widerfahren kann. Sie hat keine sofort ablesbaren Auswirkungen, und wird daher über weite Strecken gar nicht als Krise wahrgenommen – bis zu dem Zeitpunkt, an dem es zu spät ist.
Die strategische Krise bedeutet, dass das Unternehmen als Ganzes auf einem falschen Weg ist. Es ist vergleichsweise selten, dass ein Unternehmen eine völlige Neuausrichtung beschlossen hat, und diese sich als falsch entpuppt. Der übliche Weg geht über Märkte, die sich verändert haben, während das Unternehmen den alten Kurs unbeirrt weiterfährt.
Krise durch veraltete Produkte – und dadurch Rückgang der Marktanteile
Viele Produkte – dies gilt für Verbraucherprodukte genauso wie für den Business-Bereich – sind modischen Entwicklungen unterworfen. So wie alles andere sich verändert, bildet auch die Gesellschaft neue Vorlieben heraus.
In der Welt der Endkunden zeigt sich dies in allen Facetten der Gebrauchsgegenstände, und es wäre müßig, dies mit Dutzenden Beispielen zu untermauern, da man diejenigen Gegenstände, die einer Mode unterworfen sind, täglich tausendfach zu sehen bekommt.
Vor der Industrie macht die Kraft der Veränderung keineswegs halt. Wer in den 80er Jahren eine Produktionshalle betreten hat, wird möglicherweise gar nicht bemerkt haben, dass alle Maschinen mit dem gleichen Farbton lackiert waren. Ob Drehbänke von Index, Profilbiegemaschinen von Indumasch oder Trumpf Stanzwerkzeuge – alle waren einheitlich in RAL 6011 Resedagrün lackiert. Eine reine Modeerscheinung, die heute nur noch selten zu finden ist. Eine Einheitsfarbe existiert nicht mehr. Die Hersteller bieten längst eine breite Auswahl an Pulverbeschichtungen und Lackierungen an. Käufer suchen die Farben, die sich am ehesten mit dem Farbraum der eigenen Corporate Identity vereinen lassen.
Achten Sie ruhig darauf: Jeder Schaltschrank, jeder Kabelkanal, die meisten Stromkabel und fast alle Lampengehäuse sind derzeit noch in RAL 7035 Lichtgrau lackiert, gegossen oder beschichtet.
Wir können jetzt schon auf die Zeit warten, in der sich dieser Quasi-Standard verloren hat.
Ein Hersteller, der die Trends verschläft, und seine Produkte nicht auf dem Stand aktueller Vorlieben hält, wird einen spürbaren Rückgang bei den Marktanteilen erleben. Sich ändernde Käufergewohnheiten sind das prominenteste Beispiel, in dem ein Unternehmen durch reines Nichtstun, durch das Unterlassen nötiger Anpassungen in die Krise geraten ist.
Krise durch neue Vertriebswege, die nicht angenommen werden
Bis in die späten 80er und frühen 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein war der Vertreter Gang und Gäbe, der mit dem Auftragsbüchlein in der einen, und dem Musterköfferchen in der anderen Hand seine Runden dreht, und von Kunde zu Kunde fährt.
Nur wenige, hochspezielle Geschäfte wurden auf andere Art geschlossen – doch Gebrauchs-, Handels- und Industriegüter wurden zu weiten Teilen auf diese Art vertrieben.
Davon ist in der heutigen Zeit fast nichts mehr übrig. Dies liegt einerseits an neuen Möglichkeiten, die es früher nicht gab, es liegt aber auch an modischen Erscheinungen, und es liegt an der Veränderung der Märkte.
Modische Veränderungen können zum Beispiel beobachtet werden am wachsenden Umweltbewusstsein. Viele Geschäftsleute sind – dort, wo das möglich ist – vom Auto auf die Bahn umgestiegen, wenn sie verreisen wollen, um Verhandlungen zu führen und Verkäufe zu tätigen. Nicht zuletzt durch die 2020er Virenlockdowns wurden Videokonferenzen zu einem Werkzeug, das seitdem jedermann verwendet.
Dies wurde erst möglich durch die Verbreitung des Internet. Große Teile des Vertriebs sind in die Online-Welt abgewandert. E-Commerce, Online-Shopping, elektronische Ausschreibungen, Versteigerungs-Plattformen und Online-Handelsplätze haben viele der Prozesse an sich gerissen, die früher noch zwischen mehreren Personen in einem Meetingraum ausgehandelt wurden.
Auf der Nachfrageseite hat sich ebenfalls viel geändert. Insbesondere im Bereich Medien – zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften, Schallplatten, Videos, Bücher oder Spiele – sind ein Großteil der angebotenen Waren durch digitale Produkte ersetzt oder ergänzt worden, die nur noch durch einen Download-Link ausgeliefert werden.
Dies alles sind Entwicklungen, die nicht von Menschen oder Unternehmen angestoßen wurden, sondern die weltweit entstanden sind, ohne, dass sie hätten aufgehalten werden können. Wer sich diesen Entwicklungen gegenüber verschließt, begibt sich in Gefahr – die Krise naht.
Krise durch Ignorieren der Änderungen am Markt
Globale oder zumindest landesweite Entwicklungen tiefschürfender Art, gibt es bereits seit sehr langer Zeit. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich zum Beispiel unbemerkt ein Wandel ergeben, der vieles Verändert hat. Mehr oder weniger flächendeckend sind die Nachfragemärkte in Deutschland gesättigt geworden. Die Vollbeschäftigung nahm ein Ende, und die ersten Arbeitsämter wurden eröffnet. Aus einem saugfähigen Markt, der kaum befriedigt werden konnte, ist Verdrängungswettbewerb geworden.
Auf der Unternehmensseite waren ebenfalls große Veränderungen zu verzeichnen. Hatte die produzierende Industrie bis in die späten 80er Jahre das alleinige Ziel, möglichst viel zu produzieren, führte eine wachsende Flut an Verordnungen und Regulierungen, und die damit einhergehende Bürokratie dazu, dass Unternehmen mehr und mehr auf die Kosten schauen mussten. Damit änderte sich auch das Einkaufs- und Investitionsverhalten.
Wurden in Wirtschaftswunderzeiten Investitionen freihändig vergeben, und alles gekauft, was überhaupt jemand anbieten konnte, kamen gegen Ende des Jahrhunderts die Budgets auf. Dennoch konnte innerhalb der Budgets nahezu frei entschieden werden, welche Güter und Dienstleistungen angeschafft wurden.
Seit Mitte der 90er muss jede Investition durch Berechnung des ‚Return on Investment‘ und der ‚Total Cost of Ownership‘ gerechtfertigt werden, und jeder Pfennig wurde buchstäblich zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde.
All dies führte zwangsläufig zu neuen Vertriebswegen, die entweder durch den Kunden, aus Kostensicht, oder Dank der Veränderungen der Märkte erforderlich wurden.
Auch änderte sich die Art, in der Preise und Projektkosten kalkuliert werden.
Heutige Unternehmen, die sich den neuartigen Methoden und dem Wandel nicht anpassen können bzw. wollen, oder sich deren Nutzung gegenüber verweigern, geraten unweigerlich ins Hintertreffen.
Krise durch Verweigerung, in neue Produkte zu investieren
Mit dem Wandel wird es unumgänglich, auch an Produkten ständig weiterzuentwickeln, und neue Produkte zum Portfolio hinzuzufügen. Diese stetige Weiterentwicklung kann ein Unternehmen, je nach Branche, mal für einige Monate aussitzen – oder auch länger. Doch früher oder später werden die Konkurrenten das Unternehmen abgehängt haben, und es wird immer schwieriger werden, neue Kunden an Land zu ziehen. Dies bedeutet höhere Vertriebskosten, was das Ergebnis weiter belastet und auch die Mittel für etwaige Entwicklungen reduziert.
Höhere Vertriebskosten bedeuten niedrigere Erträge, was sich direkt auf die Liquidität niederschlägt, und über kurz oder lang in die Krise führt.
Krise durch Vernachlässigung vorher festgelegter Ziele
Mit dem Zeitpunkt der Gründung muss ein Unternehmen Ziele besitzen. Die offensichtlichsten Ziele, die für ein Unternehmen wichtig sind, leiten sich aus Ertrag, Umsatz oder Gewinn ab – und je nach Größe und Unternehmensform aus dem Shareholder Value. Doch jedes Business besteht aus einer Vielzahl mehr an Zielen, beginnend mit dem Produkt- bzw. Dienstleistungsmix, der den ursprünglichen Unternehmenszweck definiert.
Gut geführte Firmen haben daneben klare Vertriebsmodelle definiert. Mitarbeiter – existierende genau wie solche, die erst noch eingestellt werden – besitzen eine klar beschriebene Qualität. Es existiert eine genaue Planung in Bezug auf die Mitarbeiterzahl und die Organisationsstruktur. Auch die Entlohnung bis hin zu Rentenmodellen wurde vorab festgelegt.
Eine vorausschauende Geschäftsleitung hat konkrete Modelle erschaffen, anhand derer Marktdurchdringung und Marktpräsenz definiert wurden, und aus denen sich der Marktauftritt ableitet. An welcher Stelle welche Investitionen getätigt werden, welche Darlehen, falls nötig, dafür aufgenommen werden, und welche Rücklagen existieren – alle diese Eckpunkte wurden vorab als Ziel definiert und in die Planung übernommen.
Je klarer die Ziele beschrieben sind, desto häufiger kommt es vor, dass eines oder mehrere dieser Ziele verfehlt werden.
Ein verfehltes Unternehmensziel ist noch keine Krise
Auch wenn im Idealfall alle gesteckten Ziele erreicht werden, gehört es zum Entwicklungsprozess eines Unternehmens, dass hie und da ein Ziel verfehlt wird.
Dies alleine ist keine Katastrophe, und manch ein Betriebswirt wird sogar sagen, dass es eine Notwendigkeit ist. Es ist vielmehr wesentlich, wie mit dem verfehlten Ziel umgegangen wird.
Auf einen Fehlschlag in Bezug auf ein Unternehmensziel muss eine Analyse und eine Reaktion folgen. Möglicherweise war das Ziel unrealistisch – dann muss geprüft werden, welcher Teil der Planung von der Erreichung dieses Ziels abhängt, und eine neue Planung auf Grundlage realistischer Ziele aufgestellt werden.
Im Normalfall sind aber auf dem Weg zum Ziel Nachlässigkeiten und Fehler eingetreten, mit denen man sich im Detail beschäftigen muss. Manches Mal weisen diese Nachlässigkeiten auf einen systemischen Fehler hin, in anderen Fällen sind es Einzelfälle aufgrund eines unvorhergesehenen Ereignisses, die verantwortlich sind. Der häufigste Kasus ist allerdings eine Schwachstelle in der Kausalkette, die zum Verfehlen des Ziels geführt hat.
Mit Schwachstellen kann konstruktiv umgegangen werden durch Anpassung der Prozesse, Anschaffung neuer Arbeitsmittel und Werkzeuge, oder Mitarbeiterschulung – und selbstverständlich auch mit einer Kombination aus diesen Maßnahmen. In jedem Fall steht das Unternehmen nach der erfolgreichen Auseinandersetzung mit einem verfehlten Ziel besser, stabiler und gesünder da, als vorher. Deshalb darf ein verfehltes Ziel nicht per se als Katastrophe verstanden werden.
Wo die Geschäftsleitung allerdings zu einem verfehlten Ziel mit den Achseln zuckt und danach unbeirrt – vor allem aber ohne Konsequenzen – in den betrieblichen Alltag übergeht, wird der Grundstein für eine handfeste Firmenkrise gelegt.
Krise durch Starrsinn in Bezug auf eine neue Markt- und Wettbewerbssituation
Der Volksmund lehrt uns schon von Kindesbeinen an: „Schuster, bleib bei Deinen Leisten“. Es ist höchste Zeit, diesen Spruch anzuzählen, wie man es im Boxsport nennen würde. Zurecht mahnt er zwar, sich nicht ohne die nötigen Kenntnisse in riskante Abenteuer zu stürzen, doch wenn er dahingehend missverstanden wird, sich nie nach neuen Betätigungsfeldern umzusehen, richtet er großen Schaden an. Denn:
Es gibt auch andere Äcker zur Saat
Es ist noch nicht lange her – bevor es Apple iPhones gab – da war nahezu jeder Geschäftsmann mit einem ‚Blackberry‘ der Firma RIM (Research in Motion) ausgestattet. Die Firma RIM hatte als erster Hersteller ein marktreifes Produkt, das die Funktionen eines Palm-Pilot mit denen eines Mobiltelefons verband. So war es also möglich, auch E-Mails unterwegs zu lesen.
Mehr noch: den Blackberry konnte ein Nutzer schon in den frühen 2000er Jahren mit zusätzlichen Progrämmchen im Funktionsumfang erweitern. Das erste Smartphone war geboren.
Die wesentliche Verbesserung im Umgang mit einem intelligenten Assistenten war die Infrastruktur, die RIM parallel zu ihren Smartphones aufgebaut hatte. Das ganze System war so ausgelegt, dass der Blackberry im Prinzip immer online ist, und sich selber meldet, sobald die Aufmerksam des Nutzers erforderlich ist – zum Beispiel, wenn eine neue E-Mail in der Box lag.
Als im Jahr 2007 das erste iPhone auf dem Markt kam, wurde es von Geschäftsleuten zunächst als Kinderspielzeug belächelt – zu Unrecht. Das adaptive Touch-Display erlaubte eine einfache Bedienung nur mit den Fingern. PDAs, die ‚Personal Digital Assistents‘ – wie zum Beispiel der Palm Pilot – wurden hingegen mit einem Stift bedient. Blackberry setzte voll auf eine Hardware-Tastatur.
Das iPhone setzte sich durch, Blackberry hielt viel zu lange an der Tastatur fest – oder blieb bei seinen Leisten, wie das Sprichwort sagt. Und als es dann endlich auch Blackberrys mit Touchscreen gab, war der Markt bereits verteilt, denn neben dem iOS von Apple konnte Google sein eigenes Smartphone-Betriebssystem ‚Android‘ fest etablieren.
Dieser Starrsinn seitens des Blackberry-Herstellers führte zum völligen Untergang des Unternehmens. Heute stellt die Firma keine Smartphones mehr her.
Der Sieger in dieser Geschichte ist die Firma Apple, die mit ihrer Innovation – ohne Zweifel in Verbindung mit dem modernsten Design – einen ganzen Markt für sich erschließen konnte. Bemerkenswert für dieses Kapitel unseres Ratgebers sind aber diejenigen Hersteller, die Hardware für Android produzierten, allen voran das Koreanische Unternehmen Samsung.
Es ist zwar derjenige, der die Innovation bringt (in diesem Beispiel Apple), immer in der bestmöglichen Position – doch Hersteller, die den Trend schnell erkennen, und alternative, marktreife Produkte dazu anbieten können, sind deswegen nicht chancenlos. Samsung schneidet sich bis zum heutigen Tag große Stücke aus dem Smartphone-Kuchen heraus, dank der Erkenntnis, dass es auch andere Äcker zur Saat gibt.
Der Starrsinn seitens Research in Motion bzw. Blackberry (RIM änderte später die Firma in Blackberry) war es, der zum Untergang führte. Auf dem Weg nach unten schlitterte Blackberry übrigens von einer Krise in die nächste – womit wir wieder beim Thema wären.
Liquiditätskrise
Die Liquiditätskrise ist im ersten Schritt die Folge aus einigen anderen Krisen. Viele der genannten Krisen – wenn nicht gar alle – haben zur Folge, dass Marktanteile verloren gehen, Kunden abwandern, potentielle Neukunden die Konkurrenz bevorzugen, Prozesse teurer werden, Produkte und Dienstleistungen unter Preisdruck verkauft werden müssen, Leistungsträger innerhalb der Belegschaft zu anderen Arbeitgebern abwandern, und ganz allgemein der Überblick verloren geht, wohin eigentlich die ganzen Einnahmen verschwinden.
Einnahmen führen nur zu Gewinnen, wenn sie im Betrag über der Summe der Kosten liegen. Aus diesem Grund strebt jedes Unternehmen danach, vier Ziele zu erreichen:
1. Kosten zu senken – alles, was zu Kapitalabflüssen führt, wird untersucht: Personal, Raumkosten, Versicherungen, Werbung, Abschreibungen, und so weiter
2. Prozesse zu verschlanken – durch Verbesserungen der Abläufe und durch Automation werden Prozessschritte, die Kosten verursachen, aber verzichtbar sind, eliminiert
3. Absatz zu erhöhen – Werbemaßnahmen, PR, Marketing, Vertrieb werden optimiert, um Marktanteile zu gewinnen und die Menge der abgesetzten Produkte bzw. Dienstleistungen zu erhöhen
4. Umsatz lukrativer zu gestalten – diese Maßnahme unterscheidet sich von der Absatzstrategie dadurch, dass die Produkte höherwertiger angeboten und im Endeffekt teurer verkauft werden – mit dieser Strategie geht meist eine Schulung des Vertriebspersonals einher
Für jedes Element aus diesen vier Gruppen, die in der einen oder anderen Form in jedem Unternehmen vorhanden sind, lässt sich eine Abhängigkeit zu mindestens einer anderen Stellgröße bilden. Diese Abhängigkeiten oder Relationen drücken sich in Beispielen aus, wie:
· Vertriebsunterstützung durch Werbung erhöht die Kosten
· Anschaffung einer Maschine zur Automatisierung erfordert eine Investition, die zu Darlehenskosten oder Zinsverlusten führt
· Personalabbau kann zu schleppender, und damit in Bezug auf die Stückkosten teurerer Produktion führen
· Personalschulung führt zu steigenden Produktionskosten, bedingt durch die Ausfallzeiten, die durch das Fehlen der Belegschaft während der Schulungsmaßnahmen hervorgerufen wird
5: Der Einfluss von tiefschürfenden Maßnahmen auf Verkäufe und Prozesse
Dies waren, wie gesagt, nur Beispiele, um die Aussagen zu illustrieren. In jedem Unternehmen existieren unzählige dieser Verflechtungen, und jede Maßnahme, die in Bezug auf eine dieser Stellgrößen beschlossen wird, hat Auswirkungen an anderer Stelle des Unternehmens. Aus diesem Grund werden vornehmlich Entscheidungen getroffen, deren positive Wirkung nach einer gewissen und im Voraus bekannten Zeit die Kosten übertrifft.
Im Beispielgraphen sind Maßnahmen dargestellt, die Prozesse teurer machen oder neue Prozesse einführen, obschon darunter die Verkäufe leiden. Ein Beispiel hierfür wäre eine zusätzliche Management-Schicht mit einem leitenden Manager, der sich im Einstellungsgespräch gut verkauft hat, aber unnütz ist. Solche Maßnahmen sind tunlichst zu vermeiden. Die besten Maßnahmen sind solche, die Prozesse vereinfachen, und dabei noch die Verkäufe unterstützen. Beispiel gewünscht? Stecken Sie den Fehlkauf-Manager in die Abteilung für Telefonverkauf.
Die meisten Maßnahmen sind allerdings derart, dass auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen ein Nachteil entsteht. Ihre Aufgabe ist es dann, diejenigen Maßnahmen zu finden, die einen größeren Vorteil erwirken, als der Nachteil, der auf der anderen Seite steht.
Unternehmen, die nach dieser oder einer ähnlichen Vorgehensweise strukturiert und geführt sind, produzieren und verkaufen nach einer gewissen Zeit ausschließlich auf eine Weise, die zu mehr Einnahmen führt, als Kosten entstanden sind. Und weil die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ein klares positives Bild abliefert, wird in vielen Unternehmerköpfen die Idee ausgebrütet, dass ein solches Unternehmen automatisch über viel und wachsende Liquidität verfügen muss. Das ist leider ein Irrtum, der für manch einen schon gefährlich geworden ist.
Einnahmen, die über den Kosten liegen, führen nicht zwangsläufig zu mehr Liquidität
Steter Gewinn füllt die Kasse in den meisten Fällen, aber nicht immer, und nicht zwangsläufig. Aus den erwirtschafteten Gewinnen werden zum Beispiel Darlehen getilgt, oder – je nach Unternehmensform – der Geschäftsführer bezahlt. Diese Ausgaben gehen direkt zu Lasten der Liquidität.
Bei der monatlichen oder quartalsmäßigen Erstellung der BWA muss also mit der real vorhandenen Liquidität verglichen werden, um einen tatsächlichen Überblick über die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu erhalten.
Die Liquiditätskrise beginnt in dem Moment, an dem dieser Vergleich vorgenommen wird, und die Liquidität deutlich geringer ist, als vom Geschäftsführer, CFO oder Chefbuchhalter erwartet war.
Sehr gut geführte Unternehmen
In einem sehr gut geführten Unternehmen kommt diese Situation ganz einfach nicht vor. Eine Finanzbuchhaltung, die wirklich ganze Arbeit macht, kennt den Stand aller Bankkonten immer, auch ohne Nachzusehen. Wenn Diskrepanzen auftauchen, dann selten – und meist sind es dann einfache Buchungs- oder Tippfehler bei einzelnen Abrechnungen.
Gut geführte Unternehmen
Wenn sich in einem gut geführten Unternehmen die Liquidität überraschend anders herausstellt, als erwartet, wird eine genauere und systematische Analyse aller Verflechtungen zwischen Änderungen der Kenngrößen und deren Auswirkungen auf andere Bereiche erstellt. Es werden zu jeder Relation drei Fragen beantwortet:
1. In welcher Höhe rechnet sich die Änderung (zum Beispiel: wieviel Prozent mehr Umsatz kann der Vertriebsaußendienst erwirtschaften, wenn er mit schnelleren PKW ausgestattet wird?)
2. Zu welchem Zeitpunkt wird die positive Wirkung die durch die Änderung gestiegenen Kosten übertreffen – der sogenannte Return on Investment (ROI)
3. Wie hoch ist das Risiko, dass die erwartete Auswirkung nicht oder nicht in der angenommenen Weise eintrifft?
Angefangen bei der unwirtschaftlichsten Verflechtung werden dann weitere Änderungen überlegt. Ordentlich arbeitende Finanzbuchhaltungs-Systeme – idealerweise computergestützt auf Softwarebasis – können durch ‚What-If‘-Analysen, also Auswertung nach der Prämisse ‚was wäre, wenn?‘, direkt die Auswirkungen jeder einzelnen Maßnahme in der Theorie darstellen. Prozesse werden so lange auf dem Reißbrett verbessert, bis sich das Gesamtergebnis positiv auf die Liquidität auswirkt.
6: Für gutes Management darf man sich auch einmal selber auf die Schulter klopfen
Die beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt, und nach Ablauf der für den ROI notwendigen Zeit wird der Vergleich zwischen BWA und Liquidität erneut angestellt – und dann das gelungene Ergebnis bejubelt. Für die Feierlichkeiten im kleinen Kreis geht unsere Empfehlung geht ganz klar in Richtung zu einem heimischen, sortenreinen Jahrgangs-Winzersekt, anstatt eines Marken-Champagners aus dem Hause eines Großimporteurs.
‚Normale‘ Unternehmen, die ganz klar – und leider – die große Mehrheit ausmachen
Das ‚normale‘ Unternehmen – und die sind es hoffentlich, die diesen Ratgeber am aufmerksamsten lesen – stellt seine BWA fertig und ist zufrieden, wenn alles gut aussieht. Dann aber wird irgendwann später ein Scheck nicht eingelöst, eine Banküberweisung platzt, oder eine SEPA Einzugsermächtigung wird zurückgewiesen. Keine Frage! Das Konto ist leer, der Dispo ausgereizt, die Bank hat die Reißleine gezogen.
Sofort findet ein Umdenken in der Geschäftsführeretage statt. Investitionen, ob groß, ob klein, gingen bisher zu Lasten der Liquidität. Es wurde eingekauft, was man für sinnvoll erachtet hat, oder manchmal auch nur, was die Arbeit erleichtert, die Stimmung hebt oder schlicht und ergreifend Spaß macht. Jetzt ist alles anders. Jetzt wird, wie man es aus dem alten Sprichwort kennt, jeder Pfennig zweimal herumgedreht. Das heißt, es wird nicht mehr das angeschafft, was die Firma braucht, sondern es wird überall die Frage gestellt, was sich die Firma überhaupt leisten kann. Damit ist das Unternehmen in gewisser Weise fremdgesteuert – und zwar vom Kontostand.
Kleiner Einschub: die falsch verstandene Mär des teuren Einkaufs bei einem gewitzten Vertriebsmenschen
An dieser Stelle entfaltet ein zweiter Irrtum häufig seine Wirkung. Dazu ein Beispiel aus dem Vertrieb: Verhandlungen über einen Kauf haben stattgefunden, die Vorteile des Produktes wurden herausgearbeitet und die technische Machbarkeit beschrieben. Der Chef-Einkäufer stellt an irgendeiner Stelle die Frage: „Was kostet mich das alles?“.
Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Vertriebsmensch, wenn ihm die nötige Chuzpe fehlt, die Deckung fallen lässt. Er erzählt dann, dass der Preis für die Produkte so und so, der Dienstleistungsanteil dies und das, und die jährliche Wartung diesen oder jenen Betrag kostet – er bietet dann einen Aktionsrabatt von einer Handvoll Prozent an, wenn der Kunde sich innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, und pult noch den einen oder anderen Verkäufertrick aus der nach denselben benannten Kiste. Doch eigentlich hätte er die Frage zurückgeben müssen, und danach fragen, ob der Kunde denn schon ausgerechnet hat, was es das Unternehmen kosten wird, wenn die beiden Parteien sich heute trennen, ohne einen Abschluss ausgehandelt zu haben – wenn er gar nichts kauft.
„Lieber Kunde – hast Du Dir schon ausgerechnet, wie teuer es für Deine Firma kommen wird, wenn Du NICHT kaufst?“
Wir haben in der Schilderung über Entscheidungen und die Relation zu deren Auswirkungen schon beschrieben, dass jede Änderung durchkalkuliert werden kann und muss, um zu wissen, wann sie sich und in welcher Höhe sowie welcher Wahrscheinlichkeit positiv auf das Ergebnis auswirken wird. Es verhält sich mit Investitionen genauso. Jede kluge Investition erreicht bald einen Zeitpunkt, an welchem die Kosten durch eine von zwei Größen – nämlich Geld verdienen oder Kosten senken – bzw. einer Kombination aus diesen beiden ‚hereingeholt‘ wurden, wie der Volksmund es ausdrückt. Danach produziert die Investition ein dickes Plus im Ergebnis. Wurde aber auf die Investition verzichtet, fehlt dieses Plus.
Der bei Betriebswirten allseits geschätzte Onkel Dagobert – Dagobert Duck aus den ins Deutsche übersetzten Disney-Comics – mag oft zitiert werden für seine Weisheiten. Doch als er sagte: „Gespartes Geld ist verdientes Geld!“, da lag er in Bezug auf kluge Investitionen daneben.
Doch zurück zum ‚völlig normal‘ geführten Unternehmen.
Das ‚normale‘ Unternehmen und der Irrtum
Unser Beispielunternehmen hat gar keine Wahl mehr, zu entscheiden, ob eine Ausgabe sinnvoll ist oder nicht, denn ohne Liquidität gibt es hierfür keine Flexibilität. Es muss gespart werden ‚auf Deubel komm raus‘. Doch während all dies geschieht, bahnt sich im Hintergrund die nächste unangenehme Entwicklung an.
Geplatzte Schecks, zurückgewiesene Einzugsmandate, Mahnverfahren und gesprengte Kontokorrentkredite werden als Zeichen schlechter Finanzen gewertet und als solche auch gespeichert. Davon spricht niemand, sondern es tritt immer erst zutage, wenn gerade niemand damit rechnet: der Score bei den Finanzinstituten.
Was für Privatleute als ‚Umschuldung‘ bezeichnet wird – ein Wort, das durchaus seine Berechtigung hat – heißt bei einem Unternehmen in dieser Situation ‚Kapitalaufnahme‘. Es ist nicht nötig, ein hochdotierter Wissenschaftler zu sein, um sich auszurechnen, dass die Aufnahme eines Darlehens die Liquidität wieder herstellt, zumindest für eine gewisse Zeit. Hier schlägt die dritte Komponente der Liquiditätskrise (nach der Unkenntnis über die nicht vorhandene Liquidität als erster Komponente, und nach der falschen Annahme über Sparmaßnahmen als zweite) zu, denn die Kapitalaufnahme zeigt sich schwieriger als erwartet, wenn nicht sogar unmöglich.
Die Hausbank unseres Unternehmers zeigt sich hilfsbereit, ihn bei der Kapitalaufnahme zu unterstützen – sofern diese bei einem anderen Institut geschieht. Nur selber scheint sie sich in bemerkenswerter Weise dagegen zu sperren, weiteres Geld locker zu machen.
Wen wundert’s: ein Unternehmen, das gerade gezeigt hat, wie schlecht es mit Geld umzugehen vermag, kann gar nicht mit noch mehr Geld wieder aufgepäppelt werden. Das hieße nur, dem guten Geld noch schlechtes hinterherzuwerfen.
Gleichzeitig haben sich die Prozesse des Unternehmens intern verteuert. Da über jede Ausgabe auf Geschäftsführer-Ebene entschieden wird, werden diese an ihrer eigentlichen Arbeit gehindert, die Geschäfte zu führen. Die Buchhaltung muss bei jeder Zahlung überlegen, wie weit das Zahlungsziel überreizt werden kann, ohne zu weiteren Gebühren zu führen. Die Arbeit, sich mit Mahnschreiben auseinanderzusetzen, der Briefwechsel mit Gläubigern, aber auch die zusätzliche Arbeit des Presse- und PR-Teams, die Kommunikation mit Anteilseignern, Investoren und Analytikern, und die Zusammenarbeit mit Partnern, verschlingt schnell die komplette Leistung einer Person – oder sogar mehreren, je nach Unternehmensgröße – die folgerichtig im produktiven Bereich fehlt, in welchem die Wertschöpfung geschieht.
Spätestens jetzt trommelt der Unternehmer einen Krisenstab zusammen. Zumindest das hat er verstanden: das Unternehmen ist in der Krise – und zwar mittendrin und nicht nur kurz davor.
Meist wird dieser Stab durch den Steuerberater ergänzt, dem man die Kräfte eines Wunderheilers zu besitzen nachsagt (oder sich das zumindest wünscht).
Was kann in einem solchen Gremium auch anderes besprochen werden – natürlich sind Sparmaßnahmen im Zentrum der Diskussionen. Ein Posten, der immer wieder großes Sparpotential verspricht, ist beim Personal zu finden. Der natürliche Instinkt eines Unternehmers ist, seine Belegschaft vollständig halten zu können und zu wollen. Niemand soll in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, nur weil die Firma in einer Schieflage hängt. Doch auf der anderen Seite steht die Möglichkeit, das Schiff wieder flott zu bekommen. Dann würden einige wenige den Schaden auf sich nehmen, um alle anderen zu retten.
Und – ganz ehrlich – in so gut wie jedem Unternehmen gibt es ungeliebte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bei denen die Geschäftsleitung sich insgeheim ausmalt, sie bei dieser Gelegenheit gleich elegant loszuwerden. Aber unter dem Strich bleibt die Tatsache bestehen, dass die entlassenen Mitarbeiter büßen müssen für Fehler, die auf der Führungsebene gemacht wurden.
Zu Mitarbeitersituationen gibt es ein breit gefächertes Spektrum an Positionen. Sicherlich soll kein Unternehmer seine Mitarbeiter wie Inventar behandeln, sondern als Menschen respektieren – nicht nur als das, sondern als Menschen, auf deren Schultern das ganze Unternehmen getragen wird. Gleichwohl muss sich manches Unternehmen mit der Sorte Mitarbeitern auseinandersetzen, die der Firma mehr schaden, als ihr zu nützen – und dafür noch bezahlt werden. Zum zweiten Mal liefern die Sprüche Salomos (Sprüche 10, 26) eine lebhafte Schilderung dieser Situation:
Wie der Essig den Zähnen und der Rauch den Augen tut, so tut der Faule denen, die ihn senden. (Luther, 1914)
Unproduktives Verhalten bei der Arbeit zeitigt nicht nur keine Ergebnisse, sondern es wirkt auch demotivierend auf andere Mitarbeiter, bis hin zur völligen Zersetzung der Moral.
Dieser Ratgeber wird sich einer eigenen Positionierung enthalten, und jedem Leser oder jeder Leserin es selbst überlassen, wie in Personalfragen entschieden wird. Ziel des Buches ist, dass ein Unternehmen so geführt wird, dass sich die Frage nach Personalabbau nie stellen wird. Jedes Unternehmen kann, wenn es gesund ist, auch die eine oder andere ‚Niete‘ mitnehmen. Und wer weiß: Oftmals dankt das der Mitarbeiter mit einer neu entfachten Freude an der Arbeit und einer allgemein verbesserten Attitüde.
Die Sparmaßnahmen sind – ganz egal, ob sie das Personal betreffen, oder andere Bereiche – nur kurzzeitig wirkende Aufputschmittel. Wie gut oder schlecht sie funktioniert haben, wird erst die nächste periodische Abrechnung in der BWA zeigen. Dabei wird häufig übersehen, dass es immer noch ein systemisches Problem gibt, das überhaupt erst zum Liquiditäts-Engpass geführt hat. Ein solcher Missstand kann immer nur auf der Führungsebene behoben werden. Und – zur Entwarnung an alle Geschäftsleiter, die dies jetzt lesen – auch dort ist ‚Köpfe rollen lassen‘ nicht der produktive Ansatz zur Lösung, und außerdem wesentlich kostspieliger als auf der Arbeiter- und Angestelltenebene.
Im Hintergrund reißt allerdings der nächste Graben auf, denn die Belegschaft hat schon vom Kleinsten bis zum Größten verstanden, dass gerade Krisenstimmung herrscht. Auf Bereichs- und Abteilungsebene wird hektischer Aktivismus zelebriert, damit niemand mit Untätigkeit in den Fokus rückt. Doch überall ist die Anspannung und die Sorge zu spüren – und das, selbst wenn das Auftragsbuch voll und die Kundenliste lang ist, und es eigentlich genug zu tun gibt, wofür das Unternehmen bezahlt werden würde.
Wie kommt man aus dieser Krise heraus
Liquidität muss kurzfristig hergestellt werden, damit das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Doch in jedem Fall muss die Organisation auf den Prüfstand gestellt werden.
Führung und Leitung müssen in einer Weise strategisch gut aufgestellt werden, mit wasserdichter Planung glänzen, und ganz allgemein das Unternehmen dahin bringen, dass es sich in einer der ersten beiden Kategorien dieses Kapitels wiederfindet: gut geführt oder sehr gut geführt.
Im Zuge dieser Verbesserungen der Organisation wird nicht nur das ursprüngliche Problem erkannt, das zum Liquiditätsengpass geführt hat, sondern auch ein indirekter Effekt erzielt. Mitarbeiter, die Vertrauen in die Qualität der Führung schöpfen, arbeiten wesentlich motivierter. Manchmal schon unter dem Druck der drohenden Entlassung, aber häufig auch als Ergebnis aus der gesteigerten Motivation sinken die Zahlen beim Krankenstand, und die allgemeine Produktivität geht nach oben.
Es sei zum Abschluss des Themas ‚Sparmaßnahmen‘ noch gesagt, dass der Bereich ‚Steuern‘ mittelfristig sehr gutes Potential bietet, Ausgaben zu senken, und damit der Liquidität zu dienen. Es darf auf keinen Fall ignoriert oder vernachlässigt werden, denn es ist die einzige Sparmaßnahme, die einfach nur Liquidität im Haus hält, ohne dass das Geld an anderer Stelle fehlt. Wir widmen diesem Thema deshalb ein eigenes Kapitel – weiter hinten im Buch.
Zusammenfassend ist eine Liquiditätskrise im Idealfall immer vollends zu vermeiden. Wenn es dafür allerdings zu spät ist, können Sparmaßnahmen nur dazu dienen, sich etwas Zeit zu kaufen, um die wahren Gründe zu finden, und sie abzubauen. Liquidität ist die Lebensader eines Unternehmens. Wenn liquide Mittel nicht gerade für eine Investition benötigt werden, sollten sie nicht angelegt, sondern flexibel verfügbar bereitgehalten werden – und dies ist trotz des zu verbuchenden Zinsverlustes die Wahrheit.
Es sind zwei Dinge, die ein Unternehmer in Bezug auf die Liquidität stets bereithaben muss. Erstens die Liquidität selbst, und zweitens den Überblick über die Liquidität anhand der Betrachtung von BWA vs. Bankkontostände und Kasse. Liquidität verschafft dem Unternehmer ein ruhiges Gefühl, sie sorgt für Flexibilität, und sie hilft, einen guten Blickwinkel auf die Gesundheit des Unternehmens zu behalten. Schnell liquide Mittel zu benötigen, diese aber nicht zur Verfügung zu haben, ist immer teurer, als die Opportunitätskosten, die entstehen, wenn das Geld auf dem Girokonto liegt.
Wir schließen das Kapitel mit dem bei Wirtschaftsexperten anerkannten Spruch:
Liquidität ist durch nichts zu ersetzen – außer durch noch mehr Liquidität!
Eine Krise aus der Krise – die Erfolgskrise
Eine Krise ist selten eine lineare Angelegenheit. Wenn es an einer Stelle ‚kriselt‘, dann werden infolgedessen andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch werden die Probleme exponentiell. Das beste Beispiel hierfür ist die Erfolgskrise.
Ein Beispiel (Achtung: stark vereinfacht und gleichwohl überzeichnet!), das die Wirkungen einer Erfolgskrise beschreibt, und das man überall kennt, ist der Parketthandel mit Aktien. Dort kann ein Papier einen substantiellen Wert besitzen, der alle Aktionäre zufriedenstellt. Eine Kleinigkeit, die dann das Ergebnis geringfügig ins Schwanken bringt, führt zu leicht vermehrten Verkaufsangeboten besonders sensibler Portfolio-Manager.
Einige Spekulanten, die immer den Fühler ausgestreckt haben nach den leisesten Anzeichen einer Bewegung, sagen sich: „wenn der verkauft, verkaufe ich auch“. Schwupps folgen die streng nach Algorithmus handelnden Trader, dann die größeren Fonds und schließlich die Kleinanleger. Es kommt zum Kursrutsch – und das nur, weil der CEO beim Zigarettenholen seine Scheckkarte steckengelassen hat.
Das Beispiel mag überspitzt sein, aber die Erfolgskrise ist diejenige Krise, die fast die meisten Bereiche mit in die Tiefe zieht. Die Außenwirkung eines Unternehmens steht und fällt mit Erfolgen, über die zu berichten sich lohnt. Ausbleibende Erfolge schwächen die Wettbewerbs-position, und der schwere Stand Dank der geschwächten Position macht es schwierig, neue Erfolge zu verzeichnen. Damit wird auch die Kundengewinnung immer schwieriger, und selbst Bestandskunden wandern zur Konkurrenz ab.
Dieser Teufelskreis ist nicht die einzige Folge. Sinkende Umsätze und Erträge führen zu Bilanzverlusten, die wiederum von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. Zudem werden, um den täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten, meist Rücklagen aufgelöst, dadurch sinken die Eigenkapitalanteile, während meist noch Fremdkapital aufgenommen werden muss.
Eine Erfolgskrise kann nur schwerlich selber gelöst werden; die Energie der Führungsetage muss darauf gerichtet sein, eine solche Krise gar nicht erst eintreten zu lassen. Strategisch vernünftige und vorausschauende Entscheidungen sind dafür das Mittel der Wahl.
Führungskrise – das heißeste Eisen
Der Blick auf die Realität offenbart uns, dass meist Fehlentscheidungen den Weg in die Krise eröffnet haben. Die Menschen, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, versuchen sich stets, und verständlicherweise, aus der Schusslinie zu bringen.
Die Verantwortung zu übernehmen, muss Konsequenzen nach sich ziehen, und diese Konsequenzen können unangenehm sein.
Auch dadurch ergibt sich das Bild des Hundes, der sich in den eigenen Schwanz beißt. Wenn zu Beginn, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die ersten Anzeichen einer nahenden Krise zeigen, keiner die Verantwortung übernimmt, kommt es zwangsläufig dazu, dass die Anzeichen der Krise übertüncht, dass Symptome notdürftig behandelt werden.
Zu Beginn wäre die Krise vielleicht noch mit einfachen Maßnahmen abzuwenden gewesen, doch mit jedem Versuch, die Zeichen zu verbergen, wird der Aufwand größer, der dazu notwendig ist. Die Mittel, die dazu verwendet werden, fehlen an anderer Stelle und verschärfen die tatsächliche Krise umso mehr.
Es gibt auch hier einen Point of no Return: von dem Zeitpunkt ab, an dem ein Mitarbeiter der Geschäftsleitung, der verantwortlich für die Krise ist, nicht mehr haltbar wäre, werden die Maßnahmen schärfer und auch rücksichtsloser dem Unternehmen gegenüber. Es folgt eine Spirale unsinniger und überflüssiger Ausgaben, die das Ergebnis weiter belasten und sowohl die Krise verschärfen, als auch den Zwang, mit weiteren Maßnahmen die Folgen ungeschehen, oder besser ungesehen zu machen.
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in der Führungsetage
Die beschriebene Situation ergibt sich, mal in stärkerer und mal in abgeschwächter Form, an unzähligen Stellen. Meist wartet der Verantwortliche nur auf eine Gelegenheit, an der er die Bombe platzen lassen kann, ohne selber als Schuldiger dazustehen.
Eingangs war die Rede von der Regelmäßigkeit, in der falsche Entscheidungen im Management getroffen werden. Wir können nur jedem Unternehmen empfehlen, eine Kultur der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu pflegen, in der vom Kleinsten bis zum obersten Vorstand Verantwortung für Entscheidungen übernommen wird, und in der ohne Verlust der Würde auch zu gemachten Fehlern gestanden werden kann.
Die meisten der hausgemachten Krisen sind vermeidbar. Aus politischen Erwägungen oder schlicht aus falsch verstandenem Stolz, mit sehenden Augen vor die Wand fahren, und dabei dem Unternehmen Schaden zuzufügen, ist die schändlichste und gleichwohl überflüssigste Handlungsweise.
Diese Art der Aufrichtigkeit ist eine Charakterfrage, die schon vor der Einstellung eines Managers präzise ausgelotet werden muss. Auch beim bestehenden Führungspersonal kann diese Denkweise durch gezielte Trainingsmaßnahmen gefördert werden.
Führung und Frustration – Mitarbeiter zur Verantwortlichkeit anleiten
Ein Klima der Ehrlichkeit und Verantwortung muss von oben kommen. Und es muss immer beide Bestandteile haben. Die Kultur der Arbeit mit Verantwortung und die Freiheit bei der Gestaltung der Arbeit.
Ein häufig gemachter Fehler ist, die Verantwortung ohne die nötige Freiheit einzufordern. Dies wird in Positionen auffällig, in denen ein erfolgsabhängiges Gehalt bezahlt wird, wie zum Beispiel im Vertrieb. Wenn Mitarbeiter aus dem Vertrieb in eine leitende Position aufsteigen, haben sie häufig eine genaue Vorstellung, wie sie ihre Mitarbeiter führen wollen.
Mitarbeiter im Vertrieb übernehmen per se Verantwortung, indem sie sich zu einem Umsatzziel verpflichten. Damit müssen sie auch die Freiheit erhalten, selber zu entscheiden, auf welche Weise dieses Ziel erreicht wird. Wenn nun der frischgebackene Teamleiter oder Vertriebsleiter den Mitarbeitern vorgibt, wie das Ziel zu erreichen ist, dann kann von den Mitarbeitern nicht mehr erwartet werden, dass sie die Verantwortung tragen.
Obwohl diese Wechselwirkung von Verantwortung und Freiheit völlig simpel und einleuchtend ist, sind Unternehmen immer noch selten, in denen sie auch berücksichtigt wird. Zwei Folgen sind unmittelbar, die dritte kommt am Ende – die Krise. Erstens werden gute Mitarbeiter so nicht bereit sein, zu arbeiten, und schlussendlich die Firma verlassen. Diejenigen, die noch bleiben, so ist die zweite Folge, werden weniger effektiv arbeiten, als sie es sonst vermochten. Wir sind immer noch beim Beispiel Vertrieb. Weniger neue Abschlüsse mit Kunden bedeuten weniger Umsätze und weniger Sichtbarkeit am Markt – und dies ohne, dass an anderer Stelle etwas gespart wird, sondern nur aufgrund eines Management-Fehlers. Verbrannte Ressourcen sind die Folge, zusammengefasst.
Langfristig stellt sich so aber vor allem keine Kultur des eigenverantwortlichen Arbeitens ein. Kommt dann die Frage auf, ob eine sich anbahnende Krise kleingeredet und vertuscht wird, oder ob jemand früh die Verantwortung übernimmt, und so die Schäden vielleicht ganz vom Unternehmen abhält – dann steht die Antwort schon fest.
Arbeiten nach Pareto – und nach dem Minimax-Prinzip
Grundsätzlich ist es kein neuer Ansatz, zu planen, dass mit dem kleinstmöglichen Aufwand der größtmögliche Effekt erzielt werden soll. Minimaler Aufwand, Maximaler Effekt – das ist das Minimax-Prinzip. Men kennt es.
Eine sehr einfache Übung führt uns zu einem verblüffenden Ergebnis. Hierzu nehmen wir alle verschiedenen Tätigkeiten, und priorisieren sie nach folgender Regel: auf eine bestimmte Person bezogen, welchen Effekt erzielt die Tätigkeit in einer bestimmten Zeiteinheit? Diese Priorisierung ergibt immer eine Kurve, die einer Hyperbel ähnlich ist.
Die Person, also der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin, beginnt mit der Arbeit, die sie am effektivsten erledigen kann, und trägt diese in eine Liste ein. Dann diejenige mit der zweithöchsten Effektivität, und so weiter. Wird nun die Summe des Effektes der einzelnen Tätigkeiten zusammengenommen, entsteht ein Integral, ähnlich wie das, das im obigen Diagramm zu sehen ist. Die Summe der Zeiteinheiten, die für die jeweiligen Tätigkeiten herangezogen wurden, wird auf der x-Achse in Prozent der gesamt zur Verfügung stehenden Zeit angegeben.
Das Ergebnis dieser Übung ist – ganz gleich wer sie macht, und welche Tätigkeiten er ausführt – immer sehr nahe an der Erkenntnis, dass wir mit den effektivsten 20% unserer Arbeitszeit 80% der Arbeit erledigen. Ein Mitarbeiter, der darauf besteht, immer 100% seiner Arbeit erledigt zu haben, bis ins kleinste I-Tüpfelchen, der wird also 80% seiner Zeit damit verbringen, die restlichen 20% seiner Arbeit zu erledigen. Auf den letzten Metern verliert er den Großteil der Zeit, da meist die 100% gar nicht erreichbar sind – das wäre Perfektion! – er es aber dennoch verbissen versucht.
Bei Führungskräften tritt dies am deutlichsten zutage, da im Management eine Vielfalt an unterschiedlichsten Tätigkeiten anfällt, von einfach bis komplex und von simpel bis aufwändig. So kann ein Mitglied der Geschäftsleitung in relativ kurzer Zeit wichtige Personalentscheidungen treffen oder strategische Entwicklungen auf den Weg bringen, die beide einen massiven, positiven Effekt auf das Wohlergehen der Firma haben. Danach verbringt er noch viel Zeit in Meetings, die nicht seiner Anwesenheit bedürfen, oder damit, auch die letzte E-Mail seiner Inbox gelesen und beantwortet zu haben.
Führungskräfte sind – mehr als jeder andere aus der Belegschaft – aufgerufen, möglichst viel ihrer Zeit im Sektor „80% Arbeit in 20% der Zeit“ zu verbringen, und möglichst gar keine Zeit in den ganzen Rest zu stecken.
Bonus-Tipp
Weil wir gerade von E-Mails und Inbox gesprochen haben: auch die Inbox kann nach der Pareto-Regel bearbeitet werden. Dabei wird das Ergebnis allerdings eher in Richtung 5 zu 95 liegen: 5% der E-Mails vereinen 95% der Wichtigkeit in sich. Die restlichen 95% der E-Mails teilen 5% der Wichtigkeit unter sich auf. Ganz ehrlich: löschen Sie diese ungesehen!
Führungskräfte, die Ihre Arbeit linear erledigen – das heißt, es wird das erledigt, was gerade anfällt – bekommen kein Gefühl für die Effektivität, mit der ihre Zeit eingesetzt wird. Die Folge ist, dass weitreichende Management-Entscheidungen aufgeschoben, oder gar nicht erledigt werden, und dass die wichtige Zeit, die ein Manager mit Management- Aufgaben verwenden sollte, mit trivialen Tätigkeiten, also schlecht genutzt wird. Auch diese Nachlässigkeit kann direkt in die nächste Krise führen.
Das Frühwarnsystem
Um frühzeitig auf eine in der Anbahnung befindliche Schieflage reagieren zu können, ist die Zeit ein wesentlicher Faktor. Je schneller Sie reagieren, desto weniger heftig wird der Seegang werden, durch den Sie Ihr Unternehmen steuern müssen.
Die erste und übliche Möglichkeit zur Frühwarnung ergibt sich aus einer möglichst umfassenden und detailreichen Speicherung aller Leistungsdaten Ihres Unternehmens. Computergestützte Analysen sind in der Lage, Ihnen Trends aufzuzeigen, die unweigerlich in eine Krise führen, wenn nichts an der Unternehmensführung verändert wird.
Eine zweite Möglichkeit ist es, sich einige grundlegende Fragen zu beantworten, die sich jeder Unternehmer immer wieder stellen muss. Diese Fragen sind nach der Wichtigkeit geordnet. Ein weniger wichtiges Thema kann eine Weile lang ignoriert werden, ein äußerst wichtiger Punkt hingegen deutet darauf hin, dass es bereits lichterloh brennt.
Eine dritte Herangehensweise ist der Blick in sich selbst. Was fühlen Sie, was denken Sie, was wollen Sie, was versuchen Sie partout, zu vermeiden? Auch hier liegen Hinweise vergraben, die auf eine Krise hindeuten können.
Planung, Finanzplanung, Controlling
Gemäß § 238 Abs. 1 HGB ist jeder Unternehmer dazu verpflichtet, seine Bücher bzw. Handelsgeschäfte nach den Grundlagen ordentlicher Buchführung (GoB) zu führen. Nur Kleinunternehmer und Freiberufler sind von dieser Vorschrift ausgenommen.
Selbst-Test (Bonus)
Sie kennen die Grundlagen ordentlicher Buchführung nicht, bzw. Sie haben diesen Terminus noch nie gehört? Dann wissen Sie jetzt, was Ihr Problem ist. Schließen Sie diesen Ratgeber, bringen Sie Ihre Buchführung auf den Mindeststandard nach GoB, und fahren Sie dann mit dem Lesen fort!
Die GoB sind ein für alle gültiger, kleiner gemeinsamer Nenner. Eine Buchführung nach GoB ermöglicht es einem Dritten, relativ einfach einen Überblick über die Geschäftsvorfälle zu bekommen. Die GoB wurden aufgestellt, um vordergründig die Unternehmer vor Verlusten, Falschbuchungen, falscher Daten und irreführenden Informationen zu schützen. Aber machen wir uns nichts vor: Vor allem soll es einem Unternehmer damit erschwert werden, Vorgänge vorsätzlich zu verschleiern, zum Beispiel um Steuerzahlungen zu umgehen.
Eine Finanzbuchhaltung nach den GoB genügt aber nicht, um einen wirklich tiefen Einblick in alle Unternehmensbereiche zu besitzen – ein Einblick, der nötig ist, um früh eine Tendenz zu erkennen, die in die falsche Richtung geht. In unserem Beispiel haben wir betont, dass bei einer lückenlosen Finanzbuchhaltung kein Blick auf den Kontostand notwendig ist, da er der Buchhaltung – korrekte Buchungen vorausgesetzt – stets aus den Büchern bekannt sein sollte. Diese und andere Aspekte sind nicht zwingend vorgeschrieben, um dennoch Buchführung nach den GoB zu betreiben.
Einige grundlegende Fragen, die auf eine Krise hinweisen können
Die Zahlen Ihrer Buchhaltung lügen nicht, aber man muss sie lesen können und verstehen. Es gibt daneben noch andere Blickwinkel. Man kann sich dem Thema Früherkennung auch aus einer einfacheren, sofort umsetzbaren Richtung nähern. Dazu sprechen wir 8 Themen an, die harmlos beginnen und ernsthaft enden. Machen Sie sich zu jedem Thema Gedanken und beantworten Sie sie für sich – und zwar gnadenlos ehrlich. Je weniger Themen Sie zu Beginn mit ‚nein‘ beantworten, desto gesünder steht Ihre Firma da, und desto sicherer sind Sie vor einer Krise.
Geschäftsideen
Stellen Sie sich zum Aufwärmen die Frage, wie lange Ihr Unternehmen schon mit dem gleichen Geschäftsmodell arbeitet. Wann hat Ihre Geschäftsleitung zum letzten Mal eine solch tiefschürfende Veränderung eingeführt, dass man sie als neues Geschäftsmodell oder neue Geschäftsidee bezeichnen könnte? Deshalb also die Frage zum Selbsttest: Haben Sie neue Geschäftsideen?
Wenn das nicht der Fall ist, sind Sie übrigens nicht alleine. Einer Erhebung von Statista.com zufolge, die in zwölf Ländern durchgeführt wurde, gaben nur 17% an, dass sich ihr Geschäftsmodell in den letzten fünf Jahren wesentlich geändert hätte. Deshalb noch einmal: welche neuen Geschäftsideen entstehen in Ihrem Haus?
Neue Produkte – Innovationen
Setzen Sie die Frage nach Innovationen in Relation zu Ihrer Branche. Ein Unternehmen aus der Modebranche wird mehrmals im Jahr neue Produkte lancieren müssen, während alltägliche Haushaltsgegenstände durchaus über mehrere Jahre unverändert verkauft werden können. Bei manchen Dienstleistungen erübrigt sich die Frage weitgehend. So wird ein Gebäudereiniger auch in Zukunft Gebäude reinigen – vielleicht mit anderen Werkzeugen oder sogar Methoden, doch eine echte Neuerung ist nicht zu erwarten.
Stellen Sie sich also die Frage in Bezug auf Ihre Branche – vielleicht auch im Vergleich mit Ihren direkten Konkurrenten: Bringen Sie neue Produkte bzw. neue Dienstleistungen auf den Markt?
Neukundengewinnung
Verirren sich immer noch regelmäßig neue Kunden in Ihren Laden? Haben Sie erfolgreiche Vertriebler, die regelmäßig für neue Projektaufträge sorgen? Oder lebt Ihr Unternehmen in den Tag hinein mit Aufträgen Ihrer Bestandskunden?
Gefährliche Minenfelder: Lebt Ihr Unternehmen von einem großen Kunden und nur unwesentlich vielen kleinen? Und wo kommt neues Business her – von Empfehlungsgeschäften Ihrer Kunden? Glauben Sie, dass es immer so weitergehen wird? Auch diese Fragen müssen in Ihre Überlegungen mit einfließen.
Beantworten Sie nun konkret die Frage: Gewinnen Sie aktiv neue Kunden, und dies gezielt, regelmäßig und mit Erfolg?
Ergebnis aus der BWA
Sie können Ihr Betriebsergebnis aus der regelmäßigen Betrachtung der BWA ablesen. Das ‚wirkliche‘ Ergebnis erfordert aber einige Einsichten, die über die BWA hinausgehen, und etwas Bauchgefühl.
Das Ergebnis laut BWA ist keine absolut stabile Größe. Ein Unternehmen kann zum Beispiel eine abgeschriebene Maschine ‚auf Verschleiß‘ weiterverwenden. So lange das gutgeht, ist das Ergebnis in Ordnung. An dem Tag jedoch, an dem die Maschine den Geist vollends aufgibt, ist das Ergebnis rettungslos ruiniert. Da die Betriebsleitung aber schon vorher wusste, dass die Maschine irgendwann sterben wird, gilt das bis dato verzeichnete positive Ergebnis aus der BWA als ‚nicht wirklich‘.
Auch Mitarbeiter werden manchmal auf Verschleiß gefahren. Dann gilt genau das gleiche, wie bei der Maschine. Jeder erwartbare Vorfall, für den unter vorausschauenden Geschäftsführern Rücklagen gebildet werden, macht das positiv scheinende Ergebnis – wenn es keine solche Rücklagen gibt – zu einem ‚nicht wirklichen‘ Ergebnis.
Stellen Sie sich also die Frage, ob Ihr Betriebsergebnis auch unter dieser peniblen Betrachtungsweise noch gut ist. Ist es das?
Die Umsatzentwicklung
Die Frage nach dem Umsatz ist simpel. Steigt er? Steigt er nicht nur, weil er saisonal um diese Zeit immer steigt, um dann fünf Monate später wieder zurückzugehen? Dies ist ein Beispiel dafür, wie der Umsatz ehrlich zu betrachten ist, damit auch die Frage ehrlich beantwortet wird: steigt Ihr Umsatz?
Die Kostenentwicklung, und wie gut Sie sie kennen
Die Kosten im Griff zu haben, ist schnell daher gesagt. Natürlich ist jeder Unternehmer immer bemüht, Kosten im Rahmen zu halten, Verschwendung zu verhindert und unnötige Ausgaben zu minimieren. Die Kosten im Griff zu haben, bedeutet aber mehr, als diese eher generische Äußerung eines frommen Wunsches.
Als Unternehmer müssen Sie wissen, welche Kostenarten in welcher Höhe entstehen, und welche Veränderungen Ihrer Geschäftstätigkeit sich in welcher Weise auf die Kostenentwicklung auswirken. Diese Frage muss übrigens mit Augenmaß behandelt werden, damit Sie nicht eine Heisenberg’sche Unschärfe ins Spiel bringen. Wenn Sie jede auftretende Kostenart im Detail untersuchen und nach Senkungspotential abklopfen, dann wird es an einem gewissen Punkt geschehen, dass die Kosten dieses Abklopfens größer sind als das Einsparpotential. Dann hat wie bei Heisenberg die Intensität der Messung den Ist-Zustand verändert.
Denken Sie bei der Untersuchung der Kosten am besten an die eingangs beschriebene Pareto-Regel (80/20), damit die Maßnahmen nicht mehr kosten, als deren Erfolg einbringt. Dies alles bedenkend, beantworten Sie nun für sich die Frage: Haben Sie Ihre Kosten im Griff?
Die flüssigen Mittel
Da sind wir wieder bei der Liquidität. Wenn Sie schon mit unbezahlten Rechnungen, Mahnschreiben und Vollstreckungsbescheiden jonglieren, kommt diese Frage zu spät, denn dann sind Sie schon mitten in der Krise, und bedürfen nicht des Frühwarnsystems.
Denken Sie aber an die Situation, in der Sie sich Gedanken über eine außerordentliche Ausgabe machen, und feststellen, dass Sie über weit weniger flüssige Mittel verfügen, als Sie eigentlich angenommen hatten.
Oder denken Sie an den jüngsten Fall, in dem mangels Liquidität eine Kleinigkeit schiefgegangen ist, unbezahlte Rechnung oder zurückgewiesener Bankeinzug. Es kann eine Petitesse sein, für sich allein genommen. Denken Sie dann noch an die Zeit, die zwischen diesem, und dem vorangegangenen Vorfall dieser Art vergangen ist.
Wenn Ihnen all dies bewusst ist, dann beantworten Sie für sich die Frage: Wie gut ist es um Ihre Liquidität bestellt?
Die Frage nach dem Kredit bei der Bank
Niemand fragt bei der Bank nach Geld an, wenn er es gar nicht braucht. Aus diesem Grund mag die Antwort nicht klar zu geben sein, denn das wissen Sie erst dann präzise, wenn Sie diese Anfrage gestellt haben.
Wenn Sie schon seit einiger Zeit nicht mehr mit der Bank gesprochen haben, weil sie wissen, dass Sie nichts zu erwarten haben – denn die letzten drei Anfragen dieser Art wurden ohne weitere Prüfung ausgeschlagen – dann stecken Sie schon mitten in der Krise. Aber schon die Ungewissheit ist ein ganz schlechtes Zeichen.
Wenn Sie völlig ohne Zweifel wissen, dass Sie jederzeit mit Ihrer Hausbank über eine Aufstockung reden können, dann können Sie die Frage mit ‚ja‘ beantworten. Sie bemerken das übrigens sehr leicht daran, dass die Bank von sich aus auf Sie zukommt mit der Frage, ob Sie nicht eine Investition planen, oder aus einem anderen Grund zusätzliches Geld benötigen.
Mit diesem Wissen steht die Beantwortung der Frage an: Sind Sie noch kreditwürdig?